Verjährung des Werklohns
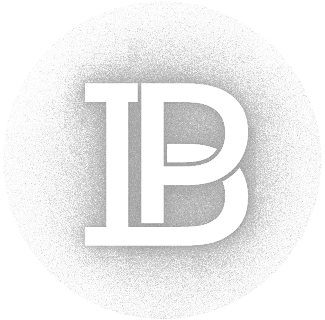
Ferdinand Bachinger
Admin | 03. September 2023
OGH vom 27.06.2023, 8 Ob 114/22f:
Die Revision macht geltend, die mit insgesamt 30.240 EUR netto geltend gemachte Forderung für außervertragliche Zusatzleistungen der klagenden Partei sei entgegen der Auffassung der Vorinstanzen verjährt. Diese Leistungen hätten nach dem vereinbarten Terminplan bis längstens 14.7.2006 erbracht werden müssen. Eine Abrechnung hätte daher unverzüglich und nicht erst mit der im September 2009 gelegten Schlussrechnung erfolgen können. Das Berufungsgericht habe die ständige Rechtsprechung missachtet, dass durch eine verspätete Rechnungslegung der Verjährungsbeginn nicht beliebig hinausgezögert werden könne.
Wurde ein Werklohn nicht im Vorhinein fix vereinbart, so wird er nicht mit der Vollendung des Werkes, sondern erst mit der Rechnungszumittlung fällig, was allerdings innerhalb verkehrsüblicher Frist geschehen muss. Mit der Fälligkeit beginnt sodann der Lauf der Verjährungsfrist. Es lässt sich keine allgemein gültige Frist festlegen, nach deren Verstreichen die Verjährung jedenfalls beginnt. Ist der Werkvertrag noch nicht zur Gänze erfüllt, so ist als Beginn der verkehrsüblichen Rechnungslegungsfrist der Zeitpunkt anzunehmen, zu dem der Auftragnehmer aufgrund der Umstände des jeweiligen Falls erkennen konnte, dass der Auftraggeber das Werk bereits für vollendet hält oder die Vollendung offenbar nicht mehr will.
Die Streitteile haben im von der Revision zitierten Architektenvertrag insoweit keine Fristen für die (spätestens dann zu bewirkende) Rechnungslegung vereinbart. Die klagende Partei war nach Punkt 11.1 des Architektenvertrags berechtigt, aber nicht verpflichtet, Abschlagsrechnungen nach Leistungsfortschritt zu legen. Die Abrechnung aller bis dahin erbrachten und noch nicht durch Abschlag verrechneten Leistungen erfolgte durch Schlussrechnung innerhalb von drei Jahren nach dem Vertragsrücktritt der Beklagten. Innerhalb dieser Frist wurde auch die Klage eingebracht.
Davon ausgehend steht die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Klagsforderung nicht verjährt ist, zur ständigen Rechtsprechung nicht in Widerspruch.
Das Neuerungsverbot erstreckt sich aber nicht auf Rechtsfragen, wenn die hiezu erforderlichen Tatsachen bereits im Verfahren erster Instanz behauptet oder festgestellt wurden und keine ausdrückliche Vorschrift besteht, die es verbietet, ohne diesbezügliche Einwendung einer Partei auf diese Rechtsfrage einzugehen. Ob im Zweifel eine bestimmte Tatsache als vorgebracht anzusehen ist, ist eine Frage des Einzelfalls, die als solche regelmäßig keine erhebliche Rechtsfrage aufwirft.
Das Berufungsgericht hat in seinem Aufhebungsbeschluss im ersten Rechtsgang eine allfällige Sittenwidrigkeit des Punktes 16.6 des Architektenvertrags thematisiert. Daraufhin hat die klagende Partei im zweiten Rechtsgang unter Verweis auf die Aufhebungsentscheidung ergänzendes Vorbringen erstattet, insbesondere dass die Beklagte die Zusammenarbeit mit dem Kläger geradezu boykottiert habe, weil sie die Ausführung des vereinbarten Projekts von Anfang an verhindern habe wollen. Wenn die Vorinstanzen dieses Vorbringen als (noch) ausreichende Grundlage für die rechtliche Prüfung dieser Vertragsbestimmung auf einen Verstoß gegen die guten Sitten behandelt haben, ist dies jedenfalls nicht unvertretbar.
Unsere Meinung dazu
Diese Entscheidung überrascht. Eigentlich sollte die Fälligkeit nichts mit der Rechnungslegung zu tun haben. Anders der OGH hier. Wenn keine Fixpreisvereinbarung getroffen worden ist, soll die Verjährung erst mit der Übermittlung der (Schluss)Rechnung zu laufen beginnen. Das ist wenig sachgerecht, da dadurch die Verjährung auf weit über 3 Jahre hinausgezögert werden könnte. Das widerspricht dem Grundsatz der Verjährung, wonach für die beteiligten Parteien in der Regel nach 3 Jahren Rechtssicherheit herrschen soll. Daher ist die Entscheidung nicht ganz verständlich, wenn auch letztinstanzlich.

