Zum konkludenten Verjährungsverzicht
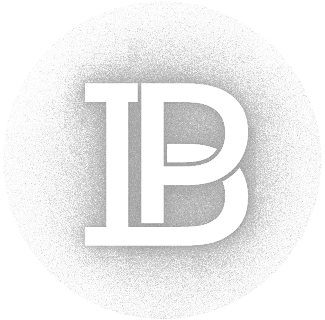
Ferdinand Bachinger
Admin | 13. April 2025
OGH vom 19.02.2025, 7 Ob 210/24v:
[1] Mit Kaufvertrag vom 14. September 2015 erwarb der Kläger im Rahmen seiner Tätigkeit als Landwirt von der Zweitbeklagten einen VW Touareg Sky V6 TDI SCR BMT 4 MOTION um 79.300 EUR, bei dem die Zweitbeklagte am 16. 5. 2018 ein Software-Update durchführte.
[2] Das Erstgericht hob über Klage vom 26. 11. 2020 (unter anderem) den zwischen dem Kläger und der Zweitbeklagten abgeschlossenen Kaufvertrag auf und verpflichtete die Zweitbeklagte zur Zahlung von 44.144 EUR sA.
[3] Das Berufungsgericht änderte diese Entscheidung dahin ab, dass es das Klagebegehren gegen die Zweitbeklagte mit Teilurteil wegen Verjährung abwies.
[4] Dagegen richtet sich die außerordentliche Revision des Klägers:
[5]
Rechtliche Beurteilung
1.1. Die Revision stellt den von der Zweitbeklagten in erster Instanz erhobenen Verjährungseinwand (grundsätzlich) nicht in Abrede und behauptet damit nur einen Verstoß gegen § 482 Abs 2 ZPO (vgl RS0042071 [T6]; RS0112215 [T1]; weitergehend Lovrek in Fasching/Konecny3 § 503 ZPO Rz 173; dagegen G. Kodek in Kodek/Oberhammer, ZPO-ON § 503 ZPO Rz 74). Unabhängig davon übergeht der Kläger aber mit seinem Argument, das Berufungsgericht hätte die Befristung des Verjährungsverzichts mangels korrespondierendem Vorbringen der Zweitbeklagten in erster Instanz nicht berücksichtigen dürfen, die Verteilung der Behauptungs- und Beweislast. Für die Einrede der Verjährung reicht es nämlich aus, dass der Beklagte jene Tatsachen, die seine Einrede zunächst einmal schlüssig begründen, vorbringt und beweist (RS0034198 [T2]; RS0034326 [T3]).
[6] 1.2. Die Revision bezweifelt nicht, dass die Zweitbeklagte diesen Anforderungen durch ihr Vorbringen in erster Instanz, die Gewährleistungsansprüche seien zum Zeitpunkt der Klageeinbringung verjährt gewesen, nachgekommen ist. Damit lag es aber am Kläger zu behaupten und zu beweisen, dass der Verjährungseinwand der Zweitbeklagten aufgrund ihres konkludenten Verjährungsverzichts arglistig und damit unbeachtlich sei (1 Ob 33/24w; vgl auch RS0034726 [T4]). Die Revision kann daher die behauptete Verletzung des Neuerungsverbots durch das Berufungsgericht nicht schlüssig darlegen.
[7] 2.1. Der Ablauf der Verjährungsfrist wird nach § 1497 ABGB durch (deklaratorisches) Anerkenntnis unterbrochen (RS0033015). Ein Anerkenntnis nach Fristablauf kann die Verjährungsfrist zwar nach ständiger Rechtsprechung nicht unterbrechen, ist aber im Regelfall als Verzicht auf die Geltendmachung der Verjährungseinrede auszulegen (RS0032401 [T7, T8, T9]; Vollmaier in Klang3 § 1497 ABGB Rz 28). Ein solcher Verzicht ist auch stillschweigend möglich (RS0032401 [T8]; 9 Ob 55/23p).
[8] 2.2. Verbesserungsversuche und Verbesserungszusagen des Übergebers sind regelmäßig als konkludentes Anerkenntnis zu werten, mit dem der Vertragspartner seine Verpflichtung zur Verbesserung anerkennt und auf die Einrede der Verjährung verzichtet (vgl RS0018921; RS0018762).
[9] 2.3. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass ein Käufer, der in Kenntnis der Betroffenheit seines Fahrzeugs vom „Dieselskandal“ zur Vornahme eines „Software-Updates“ aufgefordert wird, dies regelmäßig als Verbesserungsversuch deuten wird (8 Ob 40/23z; 5 Ob 118/23y; 10 Ob 41/23m), es sei denn, der Vertragspartner fordert den Käufer nicht selbst zur Verbesserung auf und die Installation des „Software-Updates“ erfolgt in der Werkstätte eines Dritten (5 Ob 184/23d; 10 Ob 54/23y; 9 Ob 55/23p).
[10] 2.4. Die Reichweite eines Verjährungsverzichts ist primär durch Auslegung der Erklärung im Sinn des § 914 ABGB nach dem Eindruck eines redlichen Erklärungsempfängers zu ermitteln (RS0044358 [T52]; Vollmaier in Klang3 § 1502 ABGB Rz 12). Da der nachträgliche Verzicht auf die Verjährungseinrede in der Regel unentgeltlich erfolgt, ist (sekundär) auch die Auslegungsregel des § 915 Fall 1 ABGB zu beachten (R. Madl in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.07 § 1502 Rz 4; M. Bydlinski/Thunhart in Rummel/Lukas/Geroldinger, ABGB4 § 1502 Rz 6). Dieser Frage kommt nach der Rechtsprechung regelmäßig keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zu (2 Ob 163/12b; vgl auch RS0042936).
[11] 2.5. Das Berufungsgericht vertrat die Ansicht, selbst unter der Annahme, dass die Durchführung des „Software-Updates“ im Mai 2018 als Anerkenntnis des Mangels zu werten sei, habe damit lediglich die zweijährige Gewährleistungsfrist nach § 933 Abs 1 ABGB idF GewRÄG 2001 (BGBl I 2001/48) neu zu laufen begonnen, sodass die Klage im November 2020 verfristet eingebracht worden sei.
[12] 2.6. Die außerordentliche Revision des Klägers zeigt keine aufzugreifende Fehlbeurteilung auf: Vielmehr liegt der Beurteilung des Berufungsgerichts eine nicht korrekturbedürftige Auslegung des Verjährungsverzichts der Zweitbeklagten zugrunde, kann ihr doch ohne konkret gegenteilige Anhaltspunkte im Sachverhalt nicht unterstellt werden, sie habe einen unbefristeten Verjährungsverzicht abgegeben. Die Revision kann auch gar keine stichhaltigen Anhaltspunkte nennen, warum der Erklärung der beklagten Händlerin der Aussagewert zu entnehmen sei, dass mit der Verbesserung eine unbefristete Gewährleistungszusage verbunden gewesen sei. Damit konnte der Kläger aber dem Verjährungseinwand der Zweitbeklagten angesichts seiner (verspäteten) Klagseinbringung im November 2020 nicht die Replik der Arglist (RS0014828) entgegenhalten.
[13] 3. Auf die weiteren in der Revision als erheblich behaupteten Rechtsfragen kommt es damit nicht mehr an (RS0118709 [T11]).
Unsere Meinung dazu
Die Entscheidung selbst ist unspektakulär. Der Anspruch war verjährt, weil dem beklagten Fahrzeugverkäufer nicht nachgewiesen werden konnte, dass er einen unbefristeten (!) Verjährungsverzicht abgeben wollte. Im Detail sind die Ausführungen des OGH aber sehr interessant, weil ein (verjährungsunterbrechender oder -hemmender) Verbesserungsversuch dann nicht vorliegen soll, wenn ein anderer als der Verkäufer den Käufer zur Vornahme einer Mangelbehebungsmaßnahme auffordert und der Verbesserungsversuch bei dem vom Verkäufer verschiedenen Dritten durchgeführt wird. Im Hinblick auf den hier relevanten "Dieselskandal" bedeutet dies, dass der Verkäufer den Verjährungseinwand nicht verliert, wenn eine seiner Vertragswerkstätten den Käufer zur Behebung auffordert und die Maßnahme dort durchgeführt wird. Der OGH lässt dabei vollkommen unberücksichtigt, dass der Verkäufer seine Vertragswerkstätte regelmäßig dafür bezahlt, den Mangel für ihn zu beheben und die Vertragswerkstätte dabei als Erfüllungsgehilfe des Verkäufers tätig wird. Im Ergebnis egal, der Lösungsweg erscheint aber unrichtig.

