Adäquanz von Verbesserungskosten
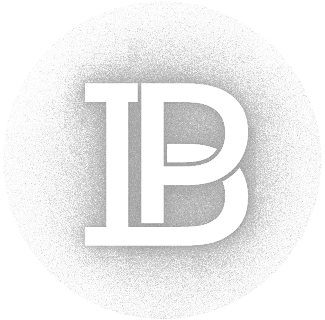
Ferdinand Bachinger
Admin | 05. Jänner 2025
OGH vom 19.11.2024, 4 Ob 188/24m:
[1] Die Nebenintervenientin beauftragte die klagende Generalunternehmerin mit der Herstellung eines kathodischen Korrosionsschutzes an acht Autobahnbrücken. Die Klägerin beauftragte ihrerseits die beklagte Subunternehmerin mit der Herstellung des Werks. Der zwischen den Parteien vereinbarte Werklohn betrug 651.616,62 EUR. Der Korrosionsschutz sollte die Korrosion der Bewehrung der Brücken minimieren und ihre Lebensdauer deutlich verlängern.
[2] In der Schlussrechnung verrechnete die Beklagte der Klägerin 1.209.233,89 EUR.
[3] Die Beklagte stellte den Korrosionsschutz nicht ordnungsgemäß her. Er erreichte weder die ausdrücklich vereinbarte und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Mindesthaftzugfestigkeit noch die ausdrücklich vereinbarte und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende durchschnittliche Mindeststärke. Das verringert seine Lebensdauer, die bei mängelfreier Herstellung 40 Jahre betragen hätte, in einem nicht näher feststellbaren Ausmaß, aber „wahrscheinlich deutlich“.
[4] Die Nebenintervenientin forderte die Klägerin zur Mängelbehebung auf, die Klägerin die Beklagte. Die Beklagte verweigerte die Verbesserung. Die Klägerin beabsichtigt, die Mängel zu beheben. Die Kosten der Mängelbehebung werden 1.921.927,32 EUR betragen.
[5] Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil, mit dem der Klägerin aus dem Titel des Schadenersatzes (unter Abweisung eines verhältnismäßig geringfügigen Mehrbegehrens sowie einer Aufrechnungseinrede) der Vorschuss der Mängelbehebungskosten von 1.921.927,32 EUR sA zugesprochen worden war.
[6] Die beklagte Werkunternehmerin macht in ihrer außerordentlichen Revision geltend, sie könne die klagende Werkbestellerin, der die Vorinstanzen das Deckungskapital für die Verbesserung des mangelhaften Werks zugesprochen haben, mit der Begründung auf „Geldersatz“ (im Sinn des § 933a Abs 2 iVm § 1167 ABGB – Minderung des Werklohns) verweisen, dass die Verbesserung für sie mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Es gelingt ihr aber nicht, eine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung aufzuzeigen (§ 502 Abs 1 ZPO).
[7] 1. Ob die begehrte Verbesserung eines Werks mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist, ist nach der Rechtsprechung durch eine Abwägung der Interessen der Parteien im Einzelfall zu klären. Dabei ist nicht allein auf die Höhe der Verbesserungskosten Bedacht zu nehmen, sondern vor allem auf die Bedeutung des Mangels und die Wichtigkeit seiner Behebung für den Besteller. Je bedeutender der Mangel und je vorteilhafter die Verbesserung für den Besteller ist, desto eher ist der Verbesserungsaufwand verhältnismäßig. Führt der Mangel nur zu einem geringen Nachteil, können schon niedrige Behebungskosten unverhältnismäßig sein. Beeinträchtigt der Mangel den Besteller dagegen wesentlich, können auch hohe Verbesserungskosten verhältnismäßig sein (RS0022044, [insb T6, T12, T13, T18, T28]) – selbst solche, die den Wert des Werks übersteigen (RS0121684, [insb T4]; RS0022063, [insb T7]). Allgemein ist der Verbesserungsaufwand nur dann unverhältnismäßig hoch, wenn er in einem offensichtlichen Missverhältnis zum Vorteil der Mängelbehebung für den Besteller steht (RS0021717). Eine „Faustregel“ für die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit ist, ob ein vernünftiger Besteller die Mängelbehebung auch auf eigene Kosten durchführen würde (RS0121684 [T4]). Es liegt am Werkunternehmer, jene Tatsachen zu behaupten und zu beweisen, aus denen sich die Unverhältnismäßigkeit des Verbesserungsaufwands ergibt (RS0128891, [insb T2]), weil das ein rechtsvernichtender Einwand ist.
[8] 2. Die Beklagte meint, das Berufungsgericht sei von dieser Rechtsprechung abgewichen, weil es die gebotene Interessenabwägung nicht durchgeführt habe. Dieser Vorwurf ist falsch: Das Berufungsgericht hat die Bedeutung des Mangels, auch anhand des Zwecks des Werks, mit der Höhe des Verbesserungsaufwands abgewogen und auf dieser Grundlage die Verhältnismäßigkeit bejaht. Dieses Vorgehen hält sich im Rahmen der Rechtsprechung.
[9] 3. Das Ergebnis der Interessenabwägung hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab und ist vom Obersten Gerichtshof nur zu korrigieren, wenn dem Berufungsgericht eine auffallende Fehlbeurteilung unterlaufen ist (RS0021717 [T7]; RS0021095). Eine solche zeigt die außerordentliche Revision nicht auf:
[10] 3.1. Die Beklagte räumt selbst ein, dass der durch eine schuldhaft vertragswidrige Werkherstellung Geschädigte nach der Rechtsprechung den Vorschuss der Verbesserungskosten fordern kann (RS0086353 [T4]; RS0018753 [T6]). Ihre Ansicht, es wäre auch zu Lasten der Klägerin in die Interessenabwägung einzubeziehen gewesen, dass sie bisher keine Ersatzvornahme eingeleitet habe, ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar. Der von der Beklagten behauptete Widerspruch der Rechtsprechung betreffend den Vorschuss der Verbesserungskosten zur oben wiedergegebenen „Faustregel“ für die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit – ob ein vernünftiger Besteller die Mängelbehebung auch auf eigene Kosten durchführen würde – liegt nicht vor: Die „Faustregel“ stellt nämlich nicht darauf ab, ob ein vernünftiger Besteller die Mängelbehebungskosten vorstrecken würde, sondern darauf, ob er die Mängel beheben lassen würde, wenn er die Kosten endgültig selbst zu tragen hätte.
[11] 3.2. Das Argument der Beklagten, bei der Interessenabwägung wäre (stärker) zu berücksichtigen gewesen, dass eine Verkürzung der Lebensdauer des Werks wegen der mangelhaften Herstellung bloß „wahrscheinlich“ sei, entfernt sich von den Feststellungen: Die mängelbedingte Verkürzung der Lebensdauer des Werks steht ausdrücklich fest. Nur das konkrete Ausmaß der Verkürzung konnte nicht näher festgestellt werden als „wahrscheinlich deutlich“.
[12] 3.3. Es trifft zu, dass der Verbesserungsaufwand sowohl den ursprünglich vereinbarten Werklohn als auch den von der Beklagten mit der Schlussrechnung angesprochenen (deutlich höheren) Werklohn erheblich übersteigt. Das macht das Ergebnis der Interessenabwägung des Berufungsgerichts aber noch nicht unvertretbar, weil es bei der Interessenabwägung nicht nur auf die – in der außerordentlichen Revision besonders betonte – Höhe der Verbesserungskosten ankommt, sondern vor allem auf die Bedeutung des Mangels und die Wichtigkeit seiner Behebung für den Besteller. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe auch aufgrund der Negativfeststellung zum Ausmaß der (feststehenden) Verkürzung der Lebensdauer des Werks im Einzelfall keine Umstände bewiesen, aus denen sich die Unverhältnismäßigkeit der Höhe des Verbesserungsaufwands ergeben könnte, ist keine auffallende Fehlbeurteilung. Die Beklagte hat zwar hohe Verbesserungskosten bewiesen, aber nicht, dass der mit der Verbesserung verbundene Vorteil des Werkbestellers so gering wäre, dass die Verbesserungskosten unverhältnismäßig hoch wären – zumal weder feststeht, dass die Verkürzung der Lebensdauer des Werks der einzige Nachteil der Klägerin ist, noch in welchem Ausmaß die Lebensdauer des Werks verkürzt wird. Es ist jedenfalls vertretbar, davon auszugehen, dass ein vernünftiger Besteller die Mängel auf eigene Kosten beheben lassen würde, damit das Werk (hier: der kathodische Korrosionsschutz an acht Autobahnbrücken) den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
[13] 3.4. Schließlich hat das Berufungsgericht die Bedeutung des Mangels auch anhand des Zwecks des Vertrags beurteilt, mit dem sich die Beklagte nicht nachvollziehbar auseinandersetzt. Auch insofern gelingt es ihr nicht, eine auffallende Fehlbeurteilung des Berufungsgerichts bei der Interessenabwägung darzulegen.
[14] 4. Auch die Frage, ob eine Partei auf ein Recht verzichtet hat, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab und kann vom Obersten Gerichtshof nur im Fall einer auffallenden Fehlbeurteilung des Berufungsgerichts beantwortet werden (RS0044298, [insb T3, T29]; RS0021095). Eine solche Fehlbeurteilung legt die außerordentliche Revision nicht dar: Es steht zwar fest, dass die Parteien die Mängel, deren Verbesserung die Klägerin beabsichtigt, im Übergabeprotokoll zunächst als „unbehebbar“ bezeichnet haben. Das Berufungsgericht hat diese Erklärung anhand mehrerer Umstände des Einzelfalls, mit denen es sich ausführlich auseinandergesetzt hat, als bloße Wissenserklärung und nicht als Verzicht auf die Verbesserung (und das Deckungskapital dafür) ausgelegt. Die Beklagte meint zwar, das sei unvertretbar gewesen, geht aber auf die vom Berufungsgericht berücksichtigten Umstände nicht ein und zeigt auch insofern keine erhebliche Rechtsfrage auf.
[15] 5. Weitere Rechtsfragen spricht die außerordentliche Revision nicht an. Sie ist daher zurückzuweisen.
Unsere Meinung dazu
Eine bittere Entscheidung für alle Baufirmen, die teilweise grobe Ausführungsmängel gerne als 'optische' oder unbedeutsame Mängel abtun und die Werkbesteller mit geringen Nachlässen abfinden wollen. Die Judikatur ist zwar nicht neu, hier hat der OGH aber klargestellt, dass die Verkürzung der Lebensdauer eines Werks zur Bedeutung des Mangels maßgeblich beiträgt. Hier betragen die Behebungskosten das Doppelte der Herstellungskosten. Trotzdem sieht der OGH keine Unverhältnismäßigkeit. Dem kann man nur beipflichten.

