Verschmelzung und Grundvekehr
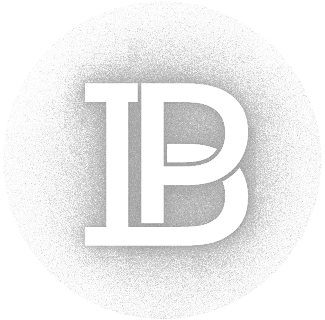
Ferdinand Bachinger
Admin | 29. Dezember 2024
OGH vom 08.10.2024, 5 Ob 16/24z:
[1] Die Erstantragstellerin ist Alleineigentümerin der drei im Kopf dieser Entscheidung genannten Liegenschaften. Auf diesen ist jeweils ein Fruchtgenussrecht für die M*gesellschaft mbH einverleibt.
[2] Die M*gesellschaft mbH wurde als übertragende Gesellschaft mit der Zweitantragstellerin als übernehmende Gesellschaft verschmolzen. Diese Verschmelzung ist seit 31. 7. 2015 im Firmenbuch eingetragen. Alleingesellschafterin sowohl der übertragenden als auch der übernehmenden Gesellschaft (und Eigentümerin der dienenden Grundstücke) ist die Erstantragstellerin.
[3] Gegenstand des Revisionsrekursverfahrens ist (nur noch) die von den Antragstellerinnen begehrte Anpassung des Grundbuchstands an die durch die Verschmelzung eingetretene Änderung der Person der Berechtigten in den bestehenden Fruchtgenusseintragungen.
[4] Das Erstgericht wies die diesbezüglichen Begehren auf Änderung der Person der Fruchtgenussberechtigten ab.
[5] Das Rekursgericht bestätigte diese Abweisung.
[6] Die vom Erstgericht genannten Gründe stünden der Eintragung zwar nicht entgegen, es liege aber ein anderes Eintragungshindernis vor.
[7] Die Antragstellerinnen stützten ihre Begehren zwar grundsätzlich zutreffend auf § 136 Abs 2 GBG. Im Falle einer Verschmelzung gehe das Vermögen der übertragenden Gesellschaft einschließlich der Schulden mit der Eintragung der Verschmelzung in das Firmenbuch im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft über, ohne dass es eines Übertragungsaktes bedürfe. Diese Rechtsänderung sei durch Berichtigung des Grundbuchs nachzuvollziehen. Als Grundlage dafür genüge der Nachweis der Unrichtigkeit, etwa – wie hier – durch die Vorlage notariell beglaubigter Firmenbuchauszüge.
[8] Die Überlassung eines land- und forstwirtschaftlichen Grundstücks zur Nutzung sei allerdings grundverkehrsbehördlich zu genehmigen. Es stelle sich somit die Frage, ob der der Verschmelzung zugrunde liegende Verschmelzungsvertrag ein Rechtsgeschäft unter Lebenden sei, das gemäß § 4 NÖ Grundverkehrsgesetz 2007 – NÖ GVG 2007 in der im Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit des Verschmelzungsvorgangs am 31. 7. 2015 geltenden Fassung der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung zu unterziehen gewesen wäre.
[9] Im Schrifttum zu § 4 NÖ GVG 2007 werde vertreten, dass der Erwerb von Gesellschaftsanteilen dann als ein Umgehungsgeschäft im Sinn dieser Bestimmung anzusehen sei, wenn mit dem Anteilserwerb unmittelbar gleichzeitig ein so hohes Einflusspotenzial erworben werde, dass von einer Liegenschaftsnutzungsbefugnis ausgegangen werden könne; in diesem Fall beziehe sich die grundverkehrsbehördliche Genehmigung mit allen ihren Konsequenzen auch darauf. Auch nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs sei beim Erwerb von Gesellschaftsanteilen mit Blick auf das grundverkehrsrechtliche Genehmigungserfordernis zu prüfen, ob dadurch eine direkte Verfügung über die Liegenschaft möglich sei.
[10] Aufgrund der zivilrechtlichen Wirkungen des Verschmelzungsvorgangs sei davon auszugehen, dass sämtliche im Jahr 2002 von der Erstantragstellerin der M*gesellschaft mbH eingeräumten Fruchtgenussrechte durch Gesamtrechtsnachfolge auf die Zweitantragstellerin übergangen seien. Dieser Übergang unterliege der Genehmigungspflicht nach § 4 NÖ GVG 2007, es komme insbesondere der dort normierte Umgehungstatbestand zum Tragen. Zwar sei nicht anzunehmen, dass Gegenstand des Verschmelzungsvertrags (allein) die Übertragung der Fruchtgenussrechte gewesen sei. Allerdings sei die Einräumung der Fruchtgenussrechte ausdrücklich gesetzlicher Auftrag an die jeweiligen, jeweils mittels Bundesgesetz errichteten Gesellschaften. Es sei daher anzunehmen, dass es zu den wesentlichen Zwecken der beiden Gesellschaften gehöre, Fruchtgenussverträge mit der Erstantragstellerin abzuschließen und der Abschluss des Verschmelzungsvertrags (zumindest auch) den Zweck hatte, den Übergang der Fruchtgenussrechte auf die Zweitantragstellerin zu bewirken. Damit erweise sich der Verschmelzungsvertrag als genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft nach § 4 Abs 2 NÖ GVG 2007.
[11] Das Rekursgericht ließ den ordentlichen Revisionsrekurs zu. Es fehle höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage, ob der Abschluss eines Verschmelzungsvertrags nach § 4 NÖ GVG 2007 genehmigungspflichtig sei.
[12] Gegen diese Entscheidung des Rekursgerichts richtet sich der Revisionsrekurs der Antragstellerinnen. Dieser ist zulässig und berechtigt.
[13] 1. Nach ständiger Rechtsprechung ist § 136 Abs 1 GBG in der Regel nur dann anzuwenden, wenn nachträglich eine Rechtsänderung außerbücherlich eingetreten ist (RS0079847 [T1]; RS0060992 [T1]) und mit der Grundbuchsberichtigung der Grundbuchstand an die wahre Rechtslage nachgeführt wird (RS0060992 [T3]; RS0061010).
[14] Als Grundlage der Eintragung genügt im Fall des § 136 GBG der „Nachweis der Unrichtigkeit“; er tritt an die Stelle der sonst (§§ 31 ff GBG) geforderten Urkunden. Dieser Nachweis ist dann erbracht, wenn die Unrichtigkeit offenkundig oder durch öffentliche Urkunden nachgewiesen ist (RS0061010).
[15] 2. Die Verschmelzung (§§ 220 bis 233 AktG [hier iVm § 96 GmbHG]) ist die Übertragung des Vermögens einer oder mehrerer Gesellschaften (übertragende Gesellschaften) im Weg der Gesamtrechtsnachfolge unter Ausschluss der Abwicklung auf eine andere bestehende oder durch die Verschmelzung neu gegründete Gesellschaft (übernehmende Gesellschaft). Mit der Verschmelzung geht das Vermögen der übertragenden Gesellschaft einschließlich der Schulden mit der Eintragung der Verschmelzung in das Firmenbuch auf die übernehmende Gesellschaft über, ohne dass es eines Übertragungsakts bedürfte. Der Vermögensübergang betrifft alle Rechte und Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft, sodass bei dieser kein Vermögen zurückbleibt. Mit der Eintragung der Fusion in das für die übertragende Gesellschaft zuständige Firmenbuch erlischt die übertragende Gesellschaft. Damit ist die Verschmelzung vollzogen (5 Ob 136/19i).
[16] Die Besonderheit der Verschmelzung liegt darin, die Beendigung der juristischen Person ohne Erfordernis eines Liquidationsverfahrens herbeizuführen (RS0049475; RS0049484). Die übernehmende Gesellschaft tritt in jeder rechtlichen Hinsicht an die Stelle der übertragenden Gesellschaft. Sämtliche Rechte und Pflichten, Forderungen und Schulden gehen (auch in Durchbrechung des bücherlichen Eintragungsgrundsatzes: RS0060147 [T3]) als Folge der liquidationslosen Beendigung der übertragenden Gesellschaft über, unabhängig davon, ob sie bekannt sind oder nicht (5 Ob 136/19i). Die einzelnen verschmolzenen selbständigen Gesellschaften werden zu einer einzigen Rechtsperson (RS0060147).
[17] Der Rechtsübergang infolge Verschmelzung ist eine besondere gesellschaftsrechtliche Form der Gesamtrechtsnachfolge, die nur in den im Gesetz geregelten Fällen zulässig ist (vgl RS0049487). Die übertragende Gesellschaft ist, wenn sie auch als selbständige juristische Person nicht mehr existiert, in der anderen juristischen Person enthalten; alle Rechte der dann vereinigten juristischen Personen sollen dabei erhalten bleiben (5 Ob 136/19i). Die übertragende Gesellschaft wirkt damit wirtschaftlich auch nach Verschmelzung als Einheit mit der übernehmenden Gesellschaft fort. Das ist Folge des Umstands, dass gerade keine Abwicklung der übertragenden Gesellschaft stattfindet, sodass ihr Erlöschen aufgrund dieses gesellschaftsrechtlichen Vorgangs auch nicht ihrem (endgültigen) Untergang, in dem Sinn, dass sie mit ihren Rechten und Pflichten aufgehört hätte zu existieren, gleichgehalten werden kann (5 Ob 136/19i).
[18] Das Vermögen der übertragenden Gesellschaft geht also mit der Eintragung der Verschmelzung in das Firmenbuch im Weg der Universalsukzession auf die übernehmende Gesellschaft über und die übertragende Gesellschaft erlischt. Mit dem mit der Eintragung vollzogenen Vermögensübergang tritt bei Liegenschaften außerbücherlich eine Rechtsänderung ein, die durch Berichtigung des Grundbuchs nach § 136 GBG bücherlich nachzuvollziehen ist (5 Ob 206/02h; 5 Ob 97/05h).
[19] 3.1. Die Grundverkehrsgesetze der Länder können (auch) den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken im Interesse der Erhaltung, Stärkung oder Schaffung eines lebensfähigen Bauernstandes durch verwaltungsbehördliche Beschränkungen regeln (Art VII B-VGNov 1974). Im Rahmen einer Adhäsionskompetenz sind die Länder dabei befugt, die zur Regelung des Gegenstands erforderlichen Bestimmungen auch auf dem Gebiet des Zivilrechts zu treffen (Art 15 Abs 9 B-VG). Das betrifft etwa Vorschriften über die Auswirkungen einer unterlassenen Genehmigung des Grunderwerbs (Rassi, Grundbuchsrecht3 Rz 7.1).
[20] 3.2. Für Niederösterreich regelt § 26 NÖ Grundverkehrsgesetz (GVG) 2007 (NÖ GVG 2007) in seiner seit 1. 1. 2015 geltenden Fassung die Zulässigkeit von grundbücherlichen Eintragungen. Danach darf ein nach diesem Gesetz genehmigungspflichtiger Rechtserwerb im Grundbuch nur eingetragen werden, wenn dem Grundbuchsgesuch der rechtskräftige Genehmigungsbescheid angeschlossen ist.
[21] Auf Beschränkungen des Grundverkehrs nach dem NÖ GVG 2007 hat das Grundbuchsgericht daher nur Bedacht zu nehmen, wenn ein genehmigungspflichtiger Rechtserwerb vorliegt. Der Motivenbericht zum Entwurf des NÖ GVG 2007 (KZ LF1-LEG-28/002-2003; in der Folge kurz: Motiven-bericht) hält dazu ausdrücklich fest, dass der Antragsteller in all jenen Fällen, in welchen keine Genehmigung notwendig ist, ohne Zwischenschaltung der Behörde direkt beim zuständigen Bezirksgericht die Eintragung im Grundbuch vornehmen lassen kann. Ziel dieser Neuregelung durch den Landesgesetzgeber war die Verringerung des Verwaltungs-aufwands durch Reduktion von Negativbestätigungen im Ausländergrundverkehr (5 Ob 229/11d). Im Grünen Grundverkehr sollten die Negativbestätigungen der Grundverkehrsbehörden zur Gänze abgeschafft werden. Anstelle dieser Bestätigungen sähen nun Sonderbestimmungen vor, dass ausschließlich die Grundbuchsgerichte im Zuge eines Urkundenverfahrens darauf zu achten haben, dass Rechtserwerbe nur entsprechend den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmetatbeständen im Grundbuch eingetragen werden (Motivenbericht Seite 6).
[22] Die Beurteilung, ob der Grundbuchseintragung ein nach den Vorschriften des NÖ GVG 2007 genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft zugrunde liegt, obliegt nach dem Willen des Niederösterreichischen Landesgesetzgebers also dem Grundbuchsgericht, das dazu die den Grundverkehr beschränkenden Regeln des Gesetzes auszulegen hat (5 Ob 229/11d).
[23] 3.3. Nach § 2 NÖ GVG 2007 in der im Zeitpunkt der hier zu beurteilenden Verschmelzung am 31. 7. 2015 geltenden Fassung ist der Geltungsbereich dieses Gesetzes auf Rechtsgeschäfte unter Lebenden über den Erwerb von Rechten an land- und/oder forstwirtschaftlichen Grundstücken, sowie an den dem Betrieb solcher Grundstücke dienenden Wohngebäuden und Wirtschaftsbauwerken oder Teilen dieser Bauwerke (Z 1) und darüber hinaus an allen Grundstücken sowie Bauwerken oder Teilen von Bauwerken beschränkt, wenn daran ausländische Personen Rechte erwerben (Z 2). Welche Rechtsgeschäfte über den Erwerb von Rechten an land- und/oder forstwirtschaftlichen Grundstücken grundverkehrsbehördlich genehmigungspflichtig sind, legt § 4 NÖ GVG 2007 fest.
[24] Das NÖ GVG 2007 gilt nach den Gesetzesmaterialien (Motivenbericht Seite 11) nur für mehrseitige Rechtsgeschäfte unter Lebenden, die vom Begriff „Rechtsgeschäfte von Todes wegen“ abzugrenzen sei. Dem NÖ GVG 2007 unterliegen demnach nicht einseitige Rechtsgeschäfte, Rechtserwerbe durch Gesetz oder Verwaltungsakte oder originäre Eigentumserwerbe, es sei denn, dass mit dieser Konstruktion die Genehmigungspflicht unzulässig umgangen wurde. Für den genannten Fall der Umgehung besteht in § 4 Abs 2 NÖ GVG 2007 ein Auffangtatbestand.
[25] § 4 NÖ GVG 2007 in der im Zeitpunkt der Verschmelzung am 31. 7. 2015 geltenden Fassung lautete:
„Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte
(1) Folgende unter Lebenden abgeschlossene Rechtsgeschäfte, die zumindest ein land- und forstwirtschaftliches Grundstück betreffen, bedürfen der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung, wenn sie zum Gegenstand haben:
1. Die Übertragung des Eigentumsrechtes;
2. die Einräumung des Fruchtgenussrechtes;
3. die Bestandgabe oder sonstige Überlassung der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung auf Flächen von über 2 ha;
4. Die Verpachtung einer Fläche bis 2 ha, wenn durch diese Verpachtung das Gesamtausmaß von 2 ha verpachteter Fläche überschritten wird.
(2) Andere Rechtsgeschäfte über land- und forstwirtschaftliche Grundstücke bedürfen der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung, wenn durch sie derselbe wirtschaftliche Zweck erreicht wird, wie durch ein in Abs. 1 angeführtes Rechtsgeschäft (Umgehungsgeschäfte).“
[26] Die Bestimmung des § 4 Abs 1 NÖ GVG 2007 über die genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte wurde mit LGBl Nr 38/2019 sprachlich vereinfacht. Seither ist jede Überlassung zur Nutzung eines land- und forstwirtschaftlichen Grundstücks genehmigungspflichtig, soweit nicht eine Genehmigungsfreiheit nach § 5 NÖ GVG 2007 vorliegt.
[27] 3.4. Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs umfassen Bestimmungen, die – wie § 2 Z 1 iVm § 4 Abs 1 NÖ GVG 2007 – nur die Übertragung des Eigentums durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden einer Genehmigung unterwerfen, die gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolge durch Verschmelzungen nicht (5 Ob 206/02h [keine Genehmigungspflicht nach § 9 lit a und § 19 lit a KrntGVG] 5 Ob 97/05h [keine Genehmigungspflicht nach § 9 StErnG]). Mit der Verschmelzung geht das Vermögen der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft über, ohne dass es eines Übertragungsakts bedürfte.
[28] In Fortschreibung dieser Rechtsprechung ist eine solche Verschmelzung kein nach § 4 Abs 1 NÖ GVG 2007 grundverkehrsbehördlich zu genehmigender Vorgang, der hier zu beurteilende, durch Verschmelzung außerbücherlich erfolgte Übergang der Fruchtgenussrechte fällt damit auch nicht in den Anwendungsbereich des § 4 Abs 1 Z 2 NÖ GVG 2007 idF vor LGBl Nr 38/2019.
[29] 3.5. Eine Bewilligungspflicht für eine Verschmelzung scheidet aus grundbuchsrechtlicher Sicht – entgegen Hoyer, Glosse zu 5 Ob 97/05h; NZ 2002/636 – aber nicht etwa schon deshalb grundsätzlich aus, weil deren Eintragung im Firmenbuch jedenfalls den (nachzuvollziehenden) außerbücherlichen Rechtsübergang der dinglichen Rechte zur Folge hat. Wenn die übertragende Gesellschaft Eigentümerin einer Liegenschaft ist, deren Übertragung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nach dem betreffenden Landesgrundverkehrsgesetz der Zustimmung der Grundverkehrsbehörde bedarf, diese Zustimmung aber nicht zur Bedingung des Verschmelzungsvertrags gemacht wurde, und die Verschmelzung in das Firmenbuch eingetragen wurde, ohne die Genehmigung durch die zuständige Grundverkehrsbehörde einzuholen, macht das Fehlen der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung die Verschmelzung nach wohl herrschender Lehre zwar nicht unwirksam. Vielmehr sind mit Eintragung der Verschmelzung in das Firmenbuch die Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft übergegangen, das jedoch mit Ausnahme des zivilrechtlichen Eigentums an den der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung unterliegenden Liegenschaften der übertragenden Gesellschaft (C. Schindler/K. Schindler in Straube/Ratka/Rauter, WK GmbHG § 96 Rz 19; Warto in Gruber/Harrer, GmbHG2 § 96 Rz 106; Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung3 § 225a Rz 80). Diese „partielle Verschmelzungswirkung“ gilt wohl nicht nur für das Eigentum, sondern auch für andere dingliche Rechte, wie das Fruchtgenussrecht.
[30] 3.6. Zu klären bleibt damit die Frage, ob sich die Genehmigungspflicht der hier zu beurteilenden Verschmelzung aus dem Auffangtatbestand des § 4 Abs 2 NÖ GVG 2007 für den der Umgehung ergibt.
[31] Das Rekursgericht bejaht dies; die von ihm zur Begründung seiner Auffassung zitierte Rechtsprechung (6 Ob 27/10d) und Literatur (Kalss, Gesellschaftsrechtliche Implikationen des Grundverkehrsrechts, wobl 1996, 1; Semper, Der Ausländer-Grundverkehr im Share-Deal, ecolex 2010, 608) bezieht sich allerdings auf den – hier nicht vorliegenden – Erwerb von Gesellschaftsanteilen und ist daher nicht unmittelbar einschlägig. Hier ist zu beurteilen, ob die Übertragung der Fruchtgenussrechte durch Verschmelzung (im Wege der Gesamtrechtsnachfolge) im Sinn des Auffangtatbestands des § 4 Abs 2 NÖ GVG 2007 als Umgehung der direkten – und jedenfalls genehmigungspflichtigen – Übertragung der Fruchtgenussrechte durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden (im Wege der Einzelrechtsnachfolge) gesehen werden kann.
[32] Nach allgemeinen Grundsätzen liegt ein Umgehungsgeschäft dann vor, wenn ein Rechtsgeschäft zwar nicht dem Buchstaben des Gesetzes nach gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, im Ergebnis aber doch den Zweck des Gesetzesverbots vereitelt, wenn also die Parteien die von einer Norm angeordnete Rechtsfolge dadurch vermeiden, dass sie ein Rechtsgeschäft schließen, das dem Wortlaut nach nicht von dieser Norm betroffen ist, das jedoch den gleichen Zweck erfüllt wie das verbotene Geschäft (RS0018173). Das Umgehungsgeschäft unterliegt der Rechtsnorm, die auf das in Wahrheit beabsichtigte Rechtsgeschäft anzuwenden ist (RS0045196; RS0038704 [T5]; RS0016469 [T9]; RS0038675 [T7, T8]; RS0113579 [T2]). Es ist dabei auf den Normzweck abzustellen. Würde der Normzweck durch die Zulassung des Umgehungsgeschäfts vereitelt werden, ist das Umgehungsgeschäft wie das eigentlich angestrebte Geschäft zu behandeln (2 Ob 26/21v; RS0018153).
[33] Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs ist eine subjektive Umgehungsabsicht für den Tatbestand des Umgehungsgeschäfts im Allgemeinen – von gesetzlichen Ausnahmetatbeständen (wie etwa § 2 Abs 3 MRG) abgesehen – nicht erforderlich (6 Ob 135/12i; RS0016780; RS0016792; RS0018114; gegenteilig zur Konsequenz der Nichtigkeit allerdings 8 Ob 526/92 = RS0018179 [Sgb GVG]). Es genügt, dass das Umgehungsgeschäft objektiv den Sinn und Zweck der umgangenen Norm vereitelt; auf eine spezielle Umgehungsabsicht der Parteien kommt es nicht an (RS0016780 [T1]; RS0016469 [T5]). Wiederholt wurde jedoch das Bewusstsein der Parteien gefordert, die vom Gesetz gezogenen Grenzen oder Schranken zu umgehen (RS0016780 [T5]; RS0018114; 9 Ob 18/14h [Vbg GVG]).
[34] Dem Gesetzeswortlaut nach setzt auch der Tatbestand des § 4 Abs 2 NÖ GVG 2007 eine Umgehungsabsicht nicht voraus; schließlich stellt dieser nur darauf ab, dass durch andere Rechtsgeschäfte „derselbe wirtschaftliche Zweck erreicht wird“. In einem Klammerausdruck werden solche Rechtsgeschäfte allerdings unter dem Begriff „Umgehungsgeschäfte“ zusammengefasst. Die Gesetzesmaterialien zum NÖ GVG 2007 verweisen dazu auf das allgemeinem Sprachverständnis, wonach ein Umgehungsgeschäft ein Rechtsgeschäft sei, das einen Erfolg auf einem Umweg anstrebe. Es sei der Versuch, auf einem Umweg etwas zu erreichen, was auf direktem Weg nicht erreichbar erscheine. Eine unerlaubte Umgehung stehe nach § 38 Abs 1 Z 3 NÖ GVG 2007 unter Strafsanktion (Motivenbericht S 14 [zu § 4]). Von einem Umgehungsgeschäft sei zu sprechen, wenn ein Rechtsgeschäft zwar nicht dem Buchstaben des Gesetzes nach gegen ein gesetzliches Verbot verstoße, im Ergebnis jedoch den Zweck des Gesetzesverbots vereitle. Ein solches Umgehungsgeschäft unterliege nach ständiger Rechtsprechung der Rechtsnorm, die auf das in Wahrheit beabsichtigte Rechtsgeschäft anzuwenden sei. Die Bestimmung (gemeint offenbar § 916 Abs 1 ABGB) sei bei der Auslegung heranzuziehen. Der Begriff „Umgehung“ sei in der Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts (etwa VfSlg 11.754, 13.194, 13.380) ein gefestigter Begriff (Motivenbericht S 28 [zur Feststellungsklage nach § 35 NÖ GVG 2007]).
[35] In der in den Materialien zitierten Entscheidung B 885/92 VfSlg 13.380 findet sich eine besonders ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff des Umgehungsgeschäfts im grundverkehrsrechtlichen Kontext. Darin verwies der Verfassungsgerichtshof auf die von der belangten Behörde sorgfältig begründete und vertretbare rechtliche Beurteilung der (Vor-)Frage, ob ein nichtiges Umgehungsgeschäft im Sinne des § 879 ABGB vorliegt. Gemäß den Gründen des dort bekämpften Bescheides ist für das Umgehungsgeschäft kennzeichnend, dass die Parteien, um den Zweck der Gesetzesumgehung zu erreichen, vielfach rechtliche Wirkungen in Kauf nähmen, die ihren wahren wirtschaftlichen Zwecken nicht entsprechen; anders sei aber der angestrebte Erfolg, die Umgehung des Gesetzes, nicht zu erreichen. Wollten die Parteien das Gesetz umgehen, dann seien sie gezwungen, die tatsächlichen Verhältnisse so zu manipulieren, dass der Sachverhalt dem Gesetz nicht mehr unterstellt werden könne. Die Parteien versuchten, bestimmten, für sie ungünstigen Rechtssätzen durch Umgestaltung (Manipulation) des Sachverhalts auszuweichen (vgl auch B 724/92 VfSlg 13.211; B 131/06 VfSlg 18129).
[36] Dieses in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck gebrachte Verständnis des Begriffs „Umgehung“ zeigt den Willen des Niederösterreichischen Landesgesetzgebers, den Tatbestand des Umgehungsgeschäfts iSd § 4 Abs 2 NÖ GVG 2007 an eine subjektive Umgehungsabsicht zu knüpfen. Für diese Annahme, der Tatbestand setzte eine subjektive Umgehungsabsicht voraus, spricht auch die Tatsache, dass § 38 Abs 1 Z 3 NÖ GVG 2007 Umgehungshandlungen nach § 4 Abs 2 NÖ GVG 2007 unter Strafsanktion steht. Verwaltungsübertretungen sind in der Regel verschuldensabhängig (vgl § 5 VStG).
[37] Allein der Umstand, dass de facto ein „Wechsel“ der (juristischen) Person des Berechtigten erfolgt, es also objektiv zu einem Übergang des Rechts (hier Fruchtgenussrechts) kommt, vermag eine Genehmigungspflicht iSd § 4 Abs 2 NÖ GVG 2007 daher nicht zu bewirken. Diese Bestimmung ist nicht auf alle Rechtsgeschäfte anzuwenden, die zu einer Änderung des Berechtigten von an land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften bestehenden Nutzungsrechten führten, sondern nur auf jene, mit welchen die Genehmigungspflicht des § 4 Abs 1 NÖ GVG 2007 umgangen werden soll. Für diesen gesetzlichen Ausnahmetatbestand ist eine subjektive Umgehungsabsicht für den Tatbestand des Umgehungsgeschäfts erforderlich.
[38] Dieses klare Auslegungsergebnis steht auch im Einklang damit, dass die Genehmigungspflichten der einzelnen Grundverkehrsgesetze, und damit auch die hier zu beurteilende Bestimmung zu Umgehungsgeschäften, grundsätzlich einschränkend auszulegen, nicht schematisch sondern einzelfallorientiert anzuwenden und jeweils auf ihre Zweckgerechtigkeit hin zu überprüfen sind (vgl 6 Ob 27/10d). Die vom Rekursgericht vertretene gegenteilige Ansicht führte dazu, dass gemäß § 4 NÖ GVG 2007 jede Verschmelzung, bei der die übertragende Gesellschaft über land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften oder Rechte an solchen verfügt, genehmigungspflichtig wäre. Die Verschmelzung wäre damit aber Rechtsgeschäften unter Lebenden ganz generell gleichgestellt.
[39] 3.7. Bestehen keine konkreten Anhaltspunkte für eine Umgehungsabsicht, ist die Verschmelzung demnach genehmigungsfrei.
[40] In der hier zu beurteilenden, durch die vorgelegten Urkunden dokumentierten Konstellation gibt es solche Anhaltspunkte für eine subjektive Umgehungsabsicht nicht. Das gilt nicht ausschließlich, aber im Besonderen wegen des Sonderfalls der Verschmelzung zweier durch Gesetz oder aufgrund spezialgesetzlicher Ermächtigung gegründeten Gesellschaften, den in den einschlägigen Gesetzesmaterialien dokumentierten Zwecken der Verschmelzung (1685 BlgNR XXIV. GP 43) und dem Umstand, dass die durch das Fruchtgenussrecht belastete Grundeigentümerin (Republik Österreich) jeweils auch Alleingesellschafterin der verschmolzenen Gesellschaften ist, sich also wirtschaftlich betrachtet die Verfügungsmacht letztlich gar nicht ändert.
[41] In diesem Sinn ist die vom Grundbuchsgericht zu beurteilende Frage, ob eine Genehmigungspflicht nach § 4 NÖ GVG 2007 in Betracht kommt, nicht zweifelhaft. Unklarheiten über die Genehmigungsbedürftigkeit des Rechtserwerbs, die im Rahmen des Grundbuchsverfahrens als reines Urkundenverfahren nicht ausgeräumt werden könnten und denen das Gericht dadurch Rechnung zu tragen hätte, dass es die Verbücherung von der Vorlage eines Genehmigungsbescheids der Grundverkehrsbehörde oder einer sonst die Zweifel beseitigenden Bestätigung abhängig macht, bestehen hier gerade nicht.
[42] 4. Die vom Erstgericht bejahten Eintragungshindernisse hat schon das Rekursgericht mit zutreffender Begründung verneint (§ 71 Abs 3 AußStrG); andere sind nicht zu erkennen.
[43] In Abänderung der Entscheidungen der Vorinstanzen waren daher die Anträge auf Berichtigung der Person des Berechtigten (Antragsbegehren 1., 2. und 5. bis 7.) zu bewilligen.
Unsere Meinung dazu
Eine mutige und richtige Entscheidung des OGH. Nicht alle liegenschaftsbezogenen Rechtsgeschäfte unterliegen der grundverkehrsbehördlichen Genehmigungspflicht, selbst wenn es sich land- und forstwirtschaftliche Grundstücke handelt. Der OGH hat den Willen des (niederösterreichischen) Gesetzgebers Wort für Wort zerlegt und ist zum Schluss gelangt, dass nur Geschäfte in Umgehungsabsicht einer Genehmigungspflicht unterliegen. Ein bloß objektiver Anschein, dass es sich um ein Umgehungsgeschäft handeln könnte, reicht dafür nicht aus. So auch im Fall einer Verschmelzung, bei der eine Gesellschaft in einer anderen Gesellschaft vollständig aufgeht. Man wird sehen, ob der OGH diese Rechtsprechung fortschreiben wird.

