Zur Irrtumsanfechtung bei E-Autos
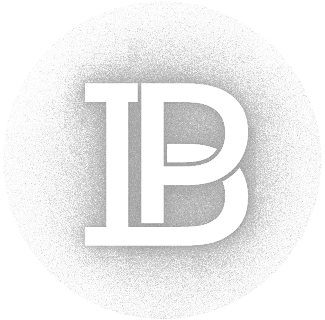
Ferdinand Bachinger
Admin | 10. August 2025
OGH vom 24.06.2025, 3 Ob 188/24d:
[1] Die Klägerin kaufte am 11. 7. 2022 bei der Beklagten den aus dem Spruch ersichtlichen PKW, ein Elektrofahrzeug der Marke *, zu einem Kaufpreis von 39.750 EUR. Die Nebenintervenientin ist die Fahrzeugimporteurin und Lieferantin der Beklagten.
[2] Die Klägerin begehrte mit ihrer Klage gestützt auf Gewährleistung, Irrtum, List, laesio enormis und Wegfall der Geschäftsgrundlage die Aufhebung des Kaufvertrags und die Rückzahlung des Kaufpreises samt Zinsen sowie die Zahlung eines Betrags von 70 EUR als pauschalen Schadenersatz für Spesen, all dies Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs. Sie brachte im Wesentlichen vor, das Fahrzeug erreiche nicht die bei den Verkaufsgesprächen vereinbarte und für die Klägerin wesentliche Reichweite von 200 km.
[3] Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage mit dem wesentlichen Vorbringen, der Klägerin sei im Rahmen der Verkaufsgespräche keine Mindestreichweite zugesagt worden. Zudem sei im Kaufvertrag vereinbart worden, dass sämtliche Vereinbarungen, Nebenabreden oder Zusicherungen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedürfen. Das Fahrzeug entspreche den Angaben des Herstellers; die Klägerin sei nicht in Irrtum geführt worden. Im Falle der Wandlung müsse sich die Klägerin ein Benützungsentgelt in Höhe der Differenz zwischen Kaufpreis und Händlereinkaufspreis von 10.520 EUR sowie auch die Reparaturkosten für einen Windschutzscheibenschaden von 1.500 EUR anrechnen lassen; beides werde als Gegenforderung compensando eingewendet. Bei einer kilometerabhängigen Berechnung des Benützungsentgelts sei vom Listenpreis von 47.056,80 EUR auszugehen.
[4] Die Nebenintervenientin ergänzte, die Reichweite des Fahrzeugs hänge von zahlreichen Faktoren, wie der Außentemperatur und dem Betrieb elektrischer Einrichtungen wie Scheinwerfer und Radio, ab. Dem Kaufvertrag seien keine Angaben zur erzielbaren Reichweite von Seiten der Fahrzeugherstellerin oder der Nebenintervenientin zugrunde gelegt worden.
[5] Das Erstgericht wies die Klage ab. Es stellte folgenden Sachverhalt fest:
[6] Der vormalige Geschäftsführer der Klägerin F* K* wollte ein neues Firmenfahrzeug kaufen. Er äußerte gegenüber seinem Filialleiter J* M*, dass bei einem Elektrofahrzeug die Reichweite immer ein Thema sei und das Fahrzeug zumindest eine Reichweite von 200 km erreichen müsse.
[7] Die Verkaufsgespräche führten sodann J* M* für die Klägerin und T* M* für die Beklagte. J* M* teilte T* M* mit, dass die Klägerin das Fahrzeug für den Außendienst verwenden und mit ihm im Umkreis von 100 km im Mühlviertel sowie hin und wieder auch nach Wien gefahren werde.
[8] Bei einem der Gespräche fragte J* M* T* M* nach der Reichweite des Fahrzeugs und erwähnte, dass es zumindest eine Reichweite von 200 km erreichen müsse. T* M* teilte daraufhin mit, dass für das Fahrzeug im Prospekt zuerst eine Reichweite von 325 km angegeben gewesen und diese nunmehr auf 285 km herabgesetzt worden sei. Auf seine Nachfrage, wie weit er mit dem Fahrzeug dann tatsächlich fahren könne, erhielt J* M* die Antwort, dass das Fahrzeug im Sommer eine Reichweite von 250 km und im Winter von 200 km erreiche. T* M* ging damals davon aus, dass das Fahrzeug diese Reichweiten erreichen kann.
[9] Es konnte nicht festgestellt werden, ob durch T* M* eine Zusicherung dahingehend erfolgte, dass das Fahrzeug diese Reichweiten garantiert und unter allen Umständen erreicht; ebenso wenig, ob T* M* hinsichtlich der Reichweite mit J* M* über Mindestwerte oder Maximalwerte sprach; ebenso wenig, ob beide darüber sprachen, dass die Reichweite des Fahrzeugs von diversen Faktoren abhängt.
[10] J* M* teilte daraufhin F* K* mit, dass T* M* ihm gegenüber gesagt habe, dass man mit dem Fahrzeug immer 200 km fahren könne. Daraufhin stimmte F* K* dem Kauf des Fahrzeugs zu. Beim Kauf waren für ihn und J* M* die Reichweite und die Größe des Fahrzeugs und eine Ladefläche wichtig und entscheidend.
[11] J* M* hatte vor dem Kauf des Fahrzeugs keine Kenntnis von Elektrofahrzeugen und deren Reichweite. Er informierte sich vor dem Kauf auch nicht über diese Themen. F* K* wusste, dass die Reichweite eines Elektrofahrzeugs von diversen Faktoren wie der Temperatur abhängig ist und die Reichweite, die ein Elektrofahrzeug tatsächlich im Realbetrieb erreicht, nicht seinem angegebenen WLTP-Wert entspricht. Ihm war klar, dass die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs 100 km weniger beträgt als für das Fahrzeug als WLTP-Wert angegeben ist. Bei dem gegenständlichen Fahrzeug handelte es sich um das erste Elektrofahrzeug der Klägerin.
[12] F* K* hätte den Kaufvertrag mit der Beklagten nicht abgeschlossen, hätte er Kenntnis davon gehabt, dass das Fahrzeug allenfalls nur eine Reichweite von unter 200 km hat.
[13] Der schriftliche Kaufvertrag enthielt folgende Klausel: „Sonstige Vereinbarungen: Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen.“
[14] Beim gegenständlichen Fahrzeug ergeben sich bei einer Umgebungstemperatur von ca 8° C – der Durchschnittstemperatur in Österreich – Reichweiten zwischen 195 und 205 km. Es wäre möglich, dass im Winter bei Temperaturen unter 0° C die Reichweite noch um ca 10 % abnimmt. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass mit dem Fahrzeug 249 bis 280 km erreicht werden können.
[15] Der Kaufpreis von 39.750 EUR war zum Kaufzeitpunkt für das Fahrzeug üblich und angemessen. Das Fahrzeug wies bei Übergabe einen Kilometerstand von 750 km auf. Sein aktueller Kilometerstand beträgt 17.300 km, seine zu erwartende Gesamtlaufleistung 250.000 km.
[16] Beim Fahrzeug ist ein Steinschlag in der Frontscheibe mit einem Sprung vorhanden. Die Reparaturkosten beliefen sich in einer Fachwerkstätte auf rund 1.500 EUR.
[17] Rechtlich vertrat das Erstgericht die Ansicht, ein Gewährleistungsanspruch der Klägerin scheitere daran, dass ihr aufgrund der Negativfeststellungen der Beweis nicht gelungen sei, dass der Zustand des Fahrzeugs im Zeitpunkt der Übergabe vom vertraglich Geschuldeten abwich. Aufgrund der Negativfeststellungen sei der Klägerin auch nicht der für eine erfolgreiche Irrtumsanfechtung erforderliche Beweis gelungen, dass T* M* bei ihr einen Irrtum veranlasst habe. Weil keine vorsätzliche Täuschung durch die Beklagte bzw T* M* vorliege, scheide auch eine Anfechtung des Vertrags wegen List aus. Auf eine Verkürzung über die Hälfte könne sich die Klägerin nicht berufen, weil der Kaufpreis von 39.750 EUR zum Kaufzeitpunkt für das Fahrzeug üblich und angemessen gewesen sei. Schließlich liege auch kein Wegfall der Geschäftsgrundlage vor, weil keine geschäftstypischen Voraussetzungen weggefallen seien.
[18] Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil dahin ab, dass der Kaufvertrag für aufgehoben erklärt und – zufolge des Ausspruchs, dass die Klageforderung mit 39.750 EUR und die Gegenforderungen mit 2.639,37 EUR zu Recht bestünden – die Beklagte für schuldig erkannt wurde, der Klägerin binnen 14 Tagen 37.110,63 EUR samt 4 % Zinsen ab 4. 5. 2023 Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu bezahlen. Hinsichtlich des Zahlungsmehrbegehrens wurde die Klageabweisung durch das Erstgericht bestätigt.
[19] Rechtlich führte das Berufungsgericht aus, der Geschäftsführer der Klägerin sei bei seiner Vertragserklärung einem Irrtum über die tatsächliche Reichweite des Fahrzeugs unterlegen, der aus den Angaben des Verhandlungsgehilfen der Beklagten resultiert habe und ohne den er das Fahrzeug nicht gekauft hätte. Die „Non-liquet-Feststellungen“ zu einer Zusicherung, dass das Fahrzeug die Reichweiten garantiert und unter allen Umständen erreiche, sowie dazu, ob man über Mindest- oder Maximalwerte gesprochen habe, änderten nichts daran, dass die Antwort auf die Frage, wie weit das Fahrzeug denn tatsächlich fahre, 200 km im Winter und 250 km im Sommer gelautet habe. Dies habe den Irrtum über die Reichweite adäquat verursacht. Betrage die Reichweite nämlich bei 8° C schon nur 195 bis 205 km, so sinke sie bei allen Elektrofahrzeugen bei niedrigen Temperaturen und könne sie nach den Feststellungen bei Temperaturen unter 0° C noch um ca 10 % abnehmen, sodass sie dann nur mehr 175,5 bis 184,5 km betrage. Somit stehe fest, dass nicht immer eine Reichweite von 200 km bestehe, was die Klägerin aufgrund der erhaltenen Auskunft aber als kaufentscheidend angenommen habe. Die Verkehrserwartung gebe wegen der konkreten Gespräche hier nicht den Ausschlag.
[20] Soweit die Beklagte aus den Feststellungen zu den Kenntnissen des Geschäftsführers der Klägerin von Elektrofahrzeugen und dem Auseinanderklaffen von WLTP-Wert und Reichweite im Echtbetrieb abzuleiten suche, dass er nicht geirrt habe, übersehe sie die Feststellung, dass er nicht gekauft hätte, hätte er von der geringeren Reichweite gewusst, was zwingend einen Irrtum bedeute. Dass die Reichweite für sie von entscheidender Bedeutung wäre, habe die Klägerin der Beklagten gegenüber auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Die wörtliche Zusage einer „Mindestreichweite“ sei dafür nicht erforderlich. J* M* habe von Beginn an kommuniziert, dass das Fahrzeug jedenfalls 200 Kilometer fahren müsse. Aufgrund des folgenden Gesprächs habe er davon ausgehen dürfen, dass diese Reichweite als Mindestwert zugesagt sei. Die Vereinbarung der Einhaltung der Schriftform für Vertragsänderungen, Nebenabreden und Zusicherungen schade nicht, weil von einer solchen Vereinbarung jederzeit auch stillschweigend wieder abgegangen werden könne.
[21] Durch die Zusage sei die Reichweite von 250 bzw 200 km als bedungene Eigenschaft anzusehen. Darüber habe sich die Klägerin in Irrtum befunden, weshalb ein beachtlicher Geschäftsirrtum vorliege. Nachdem feststehe, dass die Klägerin ohne den Irrtum den Vertrag nicht geschlossen hätte, sei der Irrtum auch wesentlich und berechtige damit zur Vertragsanfechtung. Der Kaufvertrag sei aufzuheben und rückabzuwickeln, sodass die Beklagte der Klägerin grundsätzlich den Kaufpreis von 39.750 EUR Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs zurückzuzahlen habe.
[22] Ausgehend vom Kaufpreis, 16.550 EUR von der Klägerin gefahrenen Kilometern und einer zum Kaufzeitpunkt erwartbaren Restlaufleistung von 249.250 km errechne sich anhand der Formel „Tatsächlicher Kaufpreis x gefahrene Kilometer: erwartete Restlaufleistung“ das Benützungsentgelt mit 2.639,37 EUR. In dieser Höhe bestehe die Gegenforderung der Beklagten an Benützungsentgelt zu Recht. Für die von ihr geltend gemachten Reparaturkosten für die beschädigte Windschutzscheibe biete die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung keine Grundlage, stehe der Beschädigung doch kein Nutzen der Klägerin gegenüber. Aus welchem anderen Grund sie für die Reparaturkosten einzustehen hätte, habe die Beklagte nicht vorgebracht.
[23] Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordentliche Revision nicht zulässig sei.
[24] Mit ihrer Revision beantragt die Beklagte eine Abänderung des Urteils des Berufungsgerichts im Sinn einer gänzlichen Klagsabweisung; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
[25] Die Klägerin beantragt in ihrer – vom Obersten Gerichtshof freigestellten – Revisionsbeantwortung die Zurückweisung des Rechtsmittels mangels erheblicher Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO, hilfsweise diesem den Erfolg zu versagen.
[26] Die Revision ist zulässig und teilweise auch berechtigt.
Rechtliche Beurteilung
[27] Die Begründungserleichterung nach § 510 Abs 3 zweiter Satz ZPO ist nach der Rechtsprechung auch auf Fälle anzuwenden, in denen der Oberste Gerichtshof das Berufungsurteil zwar nicht bestätigt, sich aber die Behandlung bestimmter Anspruchsgrundlagen oder Einwendungen durch das Berufungsgericht als zutreffend erweist (3 Ob 120/24d [Rz 24] mwN).
[28] Die Beurteilung des Berufungsgerichts erweist sich – abgesehen von der compensando eingewendeten, nach § 182a ZPO noch erörterungsbedürftigen Gegenforderung wegen des Schadens an der Windschutzscheibe (dazu Pkt III.) – grundsätzlich als zutreffend, weshalb darauf verwiesen werden kann. Den Ausführungen des Berufungsgerichts ist Folgendes hinzuzufügen:
[29] 1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Vertragsparteien von dem im schriftlichen Kaufvertrag enthaltenen Schriftformgebot auch für Nebenabreden und Zusicherungen einvernehmlich abgegangen seien. Aus diesem Grund seien die Angaben zur Reichweite des Fahrzeugs zum Inhalt des Vertrags geworden, weshalb ein beachtlicher Geschäftsirrtum vorliege.
[30] 1.1. Bei einer vereinbarten Schriftform kommt der Vertrag erst mit der schriftlichen Ausfertigung und Einhaltung der vereinbarten Form rechtswirksam zustande; vorher sind die Vertragsparteien nicht gebunden (RS0017249). Von einem vereinbarten Formvorbehalt können die Parteien nur einvernehmlich und nachträglich (dies jedoch auch mit Wirkung für einen vorausgehenden Vorbehalt) wieder abgehen (RS0038673; 4 Ob 143/18k). Ein einvernehmliches Abgehen erfordert übereinstimmende eindeutige (ausdrückliche oder stillschweigende) Erklärungen, die sich auf die Beseitigung des Schriftformgebots beziehen müssen. Dafür ist jedenfalls vorausgesetzt, dass sich die Gesprächspartner des Formgebots bewusst sind und davon bewusst abgehen wollen. Wenn die Gesprächspartner entweder Vertreter oder Gehilfen sind, müssen sie auch in Bezug auf die Abänderung des Formgebots befugt sein.
[31] Aufgrund der im schriftlichen Vertrag vereinbarten Schriftformklausel kommt der Vertrag erst mit der Unterschrift der Parteien zustande (§ 886 ABGB). Mit den Vertragsgesprächen, die vor diesem Zeitpunkt stattgefunden haben, konnte nicht „nachträglich“ vom vereinbarten Formvorbehalt abgegangen werden.
[32] Allerdings widerspricht es nach der Rechtsprechung den Grundsätzen des redlichen Verkehrs, wenn ein Vertragsteil dem anderen mündlich bestimmte Zusagen macht und sich hinterher auf eine damit im Widerspruch stehende Klausel in der schriftlichen Urkunde beruft (RS0014378 [T9]; vgl auch RS0017272 [T3]). Ein Verstoß gegen den redlichen Geschäftsverkehr erfordert ein Unredlichkeitsurteil, das vorliegt, wenn ein Vertragspartner seine vertragliche Position bewusst missbräuchlich ausnützt. Dies ist hier in Bezug auf die Zusage der Reichweite des Fahrzeugs der Fall, weil die Klägerin diese Eigenschaft ausdrücklich zur Geschäftsgrundlage erhob und für die Beklagte erkennbar war, dass die Klägerin auf die Richtigkeit der Reichweitenangaben vertraute. Davon ausgehend ist die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die konkreten Angaben der Beklagten zur Reichweite des Fahrzeugs zum Vertragsinhalt geworden sind, nicht zu beanstanden. An diesem Ergebnis ändert auch nichts, dass ein zweiseitiges Unternehmensgeschäft vorliegt. § 884 ABGB nimmt solche Rechtsgeschäfte nicht von seinem Anwendungsbereich aus.
[33] 1.2. Dass der Senat in der Entscheidung zu 3 Ob 77/24f – ausgehend von der dort von den Tatsacheninstanzen getroffenen Feststellung eines verkehrsüblichen Reichweitenverlusts bei Elektrofahrzeugen von bis zu 30 bis 50 % gegenüber dem WLTP-Normwert durch erhöhten Stromverbrauch bei kalten Temperaturen ab -5 bis -15° C und der Verwendung von Nebenverbrauchern wie etwa Licht und Heizung – die Beurteilung der Vorinstanzen, das Fahrzeug weise (trotz des genannten Reichweitenverlusts) die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften auf und es überspannte die Aufklärungspflicht des Verkäufers, über die Größenordnung des Reichweitenverlusts bei tiefen Temperaturen und der Verwendung von Nebenverbrauchern ausdrücklich hinzuweisen, als nicht korrekturbedürftig iSd § 502 Abs 1 ZPO qualifizierte, spricht nicht gegen dieses Ergebnis. Im dortigen gewährleistungsrechtlichen Fall wurde in der außerordentlichen Revision die Frage thematisiert, ob die Nichtunterschreitung der in den Verkaufsunterlagen angegebenen Reichweite eine gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaft sei.
[34] Demgegenüber liegt hier ein von der Beklagten iSd § 871 ABGB veranlasster Geschäftsirrtum der Klägerin vor, zumal der Umstand, über den geirrt wurde (die tatsächlich erzielbare Reichweite des Elektrofahrzeugs) zum Geschäft selbst gehört; der Verhandlungsgehilfe der Beklagten wurde ausdrücklich danach gefragt (vgl 7 Ob 111/06h; 7 Ob 178/09s [Pkt 1]).
[35] 1.3. Der Geschäftsirrtum betrifft die unrichtige Vorstellung über den Inhalt bzw Gegenstand des Geschäfts (RS0014910; RS0014902). Bei einem Geschäftsirrtum muss sich die unrichtige Vorstellung des Irrenden daher auf innerhalb des Geschäfts liegende Umstände beziehen. Ob ein Irrtum über eine bestimmte Eigenschaft des Vertragsgegenstands Geschäftsirrtum ist, hängt somit davon ab, ob die betreffende Eigenschaft Vertragsinhalt war. Es ist daher durch Vertragsauslegung auf der Grundlage des Vertragsverständnisses der Parteien zu ermitteln, ob ein Umstand zum Inhalt des Geschäfts gehörte und darüber ein Irrtum vorlag (5 Ob 195/09a; 8 Ob 19/12w). Bei der Irrtumsanfechtung gemäß § 871 ABGB muss der Kläger einen Sachverhalt behaupten, aus dem sich ergibt, dass sein Geschäftsirrtum wesentlich war und entweder vom Beklagten veranlasst wurde oder diesem aus den Umständen offenbar auffallen musste oder rechtzeitig aufgeklärt wurde (RS0093831). Nach der Rechtsprechung bedeutet „veranlassen“ nur eine adäquate Verursachung des Irrtums. Absichtlich oder zumindest fahrlässige Irreführung wird nicht vorausgesetzt; es genügt jedes für die Entstehung des Irrtums ursächliche Verhalten (RS0016195; RS0016188; 8 Ob 25/10z). In dieser Hinsicht kommen etwa unrichtige Werbeaussagen in Betracht, die einer Sache in Wahrheit nicht vorhandene Eigenschaften zumessen. Ein Irrtum wird iSd § 871 ABGB auch dann „durch den anderen Teil veranlasst“, wenn er nicht vom Vertragspartner selbst, sondern von einer Person hervorgerufen wurde, die für den Vertragspartner beim Vertragsabschluss oder bei dessen Vorbereitung als Verhandlungsgehilfe tätig war (RS0016196). Solche Gehilfen, derer sich der Vertragspartner des Irrenden bei den Vertragsverhandlungen bedient, sind nicht Dritte iSd § 875 ABGB, soweit sie im Rahmen des Auftrags tätig sind (RS0016309; 8 Ob 46/15w; 3 Ob 40/23p).
[36] Ausgehend von der getroffenen Vereinbarung war die von der Beklagten angegebene Reichweite des Fahrzeugs sowohl im Sommer als auch im Winter eine vertragsrelevante Eigenschaft. Der Irrtum des Vertreters der Klägerin über diesen Umstand wurde vom Vertreter der Beklagten aufgrund der ausdrücklichen Erklärungen, dass das Fahrzeug im Sommer eine Reichweite von 250 km und im Winter eine solche von 200 km erreiche, auch veranlasst.
[37] 2. Die Beklagte bringt in ihrer Revision vor, das Benützungsentgelt sei vom Berufungsgericht durch Heranziehung der linearen Berechnungsmethode unrichtig berechnet worden. Die angeführte Judikatur beziehe sich auf mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattete Fahrzeuge. Bei diesen müsse die Anrechnung aber dem Zweck des Schadenersatzes entsprechen und dürfe nicht zu einer unbilligen Entlastung des Schädigers führen. Richtigerweise sei hier der konkret angemessene Kaufpreis dem Händlereinkaufspreis gegenüberzustellen, was 10.520 EUR ergäbe.
[38] 2.1. Bei einer bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung eines Kaufvertrags ist neben einem Anspruch des Verkäufers auf Herausgabe der Kaufsache zusätzlich ein solcher auf Benützungsentgelt denkbar (vgl 10 Ob 2/23a vom 21. 2. 2023 [Rz 83 ff] mwN). Zwar ist ein Anspruch auf Benützungsentgelt grundsätzlich zu verneinen, weil es zu einer Pauschalverrechnung der jeweiligen Nutzungen kommt. Dies setzt aber voraus, dass die Hauptleistungen als annähernd gleichwertig angesehen werden können, was dann nicht vorliegt, wenn die benützte Sache einer starken gebrauchsbedingten Wertminderung unterliegt. Das ist bei Kraftfahrzeugen der Fall (10 Ob 2/23a vom 21. 2. 2023 [Rz 90]; 3 Ob 140/22t [Rz 55]).
[39] 2.2. In der neueren Rechtsprechung hat sich für die vom Käufer nicht zu vertretende Rückabwicklung von Autokaufverträgen die lineare Berechnung des Gebrauchsnutzens in Abhängigkeit von den gefahrenen Kilometern durchgesetzt. Dabei ist ausgehend vom Kaufpreis durch einen Vergleich zwischen tatsächlichem Gebrauch (= gefahrene Kilometer) und voraussichtlicher Gesamtnutzungsdauer (erwartete Gesamtlaufleistung bei Neuwägen und erwartete Restlaufleistung bei Gebrauchtwägen) der Gebrauchsnutzen zu bestimmen (RS0134263). Diese Judikatur wurde im Zuge der „Diesel-Fälle“ entwickelt; sie betrifft nicht nur die Rückabwicklung bei gewährleistungsrechtlicher Wandlung/Vertragsauflösung, sondern auch jene bei irrtumsrechtlicher Anfechtung (vgl 4 Ob 151/22t [Rz 38, 51]; 3 Ob 140/22t [Rz 58 f]; 3 Ob 30/23t [Rz 19]). Das Berufungsgericht hat diese Grundsätze im vorliegenden Fall angewendet.
[40] 2.3. Eine Differenzierung in der Berechnung des Gebrauchsnutzens in „Diesel-“ und sonstige Fälle lässt sich aus der Rechtsprechung nicht ableiten. Vielmehr wurde etwa in der Entscheidung zu 4 Ob 21/21y die lineare Berechnung des Benützungsentgelts bei der Rückabwicklung eines Autokaufs, weil das Fahrzeug vereinbarungswidrig keinen Allradantrieb hatte, vom Obersten Gerichtshof nicht beanstandet.
[41] Eine solche Differenzierung könnte auch in der Sache nicht überzeugen. Der Rechtsprechung liegt die Überlegung zugrunde, dass es zwar unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Benützungsentgelt zu berechnen, seine Berechnung anhand fiktiver Mietzinse aber unbillig wäre, sofern Sachen zu beurteilen sind, die auf lange Zeit üblicherweise nicht gemietet, sondern gekauft werden. Der Käufer eines Kraftfahrzeugs soll durch die Rückabwicklung nicht den hohen Wertverlust zu Beginn der Nutzung tragen müssen, wenn er die Vertragsauflösung nicht zu vertreten hat; diesem soll auch nicht der Wertverlust angelastet werden, der durch die von ihm nicht zu vertretende verzögerte Rückabwicklung nach Geltendmachung des Vertragsauflösungsrechts entstanden ist. Um die Einhaltung dieser Grundsätze zu gewährleisten, ist das Benützungsentgelt in Kfz-Fällen linear in Abhängigkeit von den gefahrenen Kilometern zu berechnen (vgl 10 Ob 2/23a vom 21. 2. 2023 [Rz 92 ff]; 3 Ob 77/23d [Rz 13]; 3 Ob 30/23t [Rz 19]).
[42] 2.4. Diese Rechtsprechung steht auch mit dem Unionsrecht im Einklang. So ergibt sich aus der Rechtsprechung des EuGH, dass der Käufer insbesondere auch bei Anwendung der Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie Wertersatz für die Nutzung schulden kann (EuGH C-404/06 [Rz 39] und 10 Ob 2/23a vom 21. 2. 2023 [Rz 104]).
[43] 2.5. Die vom Berufungsgericht angewendete Methode zur (linearen) Berechnung des Benützungsentgelts ist damit nicht zu beanstanden.
[44] 3. Die Beklagte beanstandet in ihrer Revision schließlich auch die Begründung des Berufungsgerichts für die Nichtanerkennung ihrer Gegenforderung in Höhe von 1.500 EUR für die schadhafte Windschutzscheibe, wonach die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung für diese Gegenforderung keine Grundlage biete, zumal der Beschädigung kein Nutzen der Klägerin gegenüberstehe und die Beklagte nicht vorgebracht habe, aus welchem anderen Grund die Klägerin für die Reparaturkosten einzustehen hätte. Dass das Vorbringen der Beklagten nicht ausreiche, sei nie erörtert worden.
[45] Die Beklagte macht damit das Vorliegen einer Überraschungsentscheidung sowie unrichtige rechtliche Beurteilung geltend.
[46] Sie befindet sich damit im Recht.
[47] 3.1. Für den Inhalt des Bereicherungsanspruchs wird in § 1437 ABGB auf die Bestimmungen zum Eigentümer-Besitzer Verhältnis (§§ 329–336 ABGB) verwiesen (7 Ob 672/86; Rummel in Rummel, ABGB3 [2002] Vor § 1431 Rz 23). Sowohl die Rechtsprechung (7 Ob 672/86 zur bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung bei § 1431 ABGB) als auch die Literatur (Lurger in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.09 [2023] § 1437 Rz 7 mwN) wenden die Vorschrift des § 335 ABGB über den unredlichen Besitzer bzw die dazu komplementäre Vorschrift des § 329 ABGB über den redlichen Besitzer auch bei der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung an.
[48] 3.2. Nach § 329 ABGB kann ein redlicher Besitzer „schon allein aus dem Grund des redlichen Besitzes die Sache, die er besitzt, ohne Verantwortung nach Belieben brauchen, verbrauchen, auch wohl vertilgen“. Damit ist der redliche Besitzer schon allein aus dem Grund seines redlichen Besitzes für die Sache nicht verantwortlich und auch bei ihrer Vernichtung nicht ersatzpflichtig (2 Ob 815/52 = JBl 1953, 661). Hat der redliche Bereicherungsschuldner die fremde Sache veräußert, so schuldet er – als stellvertretendes Commodum – nur den Verkaufserlös (RS0010199 [T1 und T2]).
[49] 3.3. Nach § 335 ABGB ist der unredliche Besitzer nicht nur verbunden, „alle durch den Besitz einer fremden Sache erlangte Vorteile zurück zu stellen“, sondern unter anderem auch, „allen durch seinen Besitz entstandenen Schaden zu ersetzen“. [50] Der unredliche Bereicherungsschuldner ist nach § 335 ABGB einer Haftung für Schäden ausgesetzt. Dabei handelt es sich um einen besonderen Schadenersatzanspruch (vgl 7 Ob 115/97f). In § 335 ABGB hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass bei widerrechtlicher, schuldhafter Benützung einer Sache auch für den Zufall gehaftet wird, der sich ohne diese Benützung nicht ereignet hätte (2 Ob 144/56 = SZ 29/24). Die Sonderbestimmung des § 335 ABGB erfasst jegliche Beschädigung der Sache während des unredlichen Besitzes (8 Ob 78/07i). Der Schaden muss nur durch den unredlichen Besitz adäquat verursacht worden sein (4 Ob 504/91). Auf den unredlichen Inhaber ist § 335 ABGB sinngemäß anwendbar (4 Ob 504/91; 7 Ob 115/97f).
[51] Der Bereicherungsschuldner ist jedenfalls unredlich, sobald er vom (eigenen oder fremden) Gestaltungsrecht und damit von seiner Rückstellungspflicht Kenntnis erlangt hat (3 Ob 202/23m [Rz 24] mwN).
[52] 3.4. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann der bloße Umstand, dass dem Schaden an der Windschutzscheibe kein Nutzen der Klägerin gegenübersteht, die Verneinung der erhobenen Kompensandoforderung für den Steinschlag nicht begründen. § 335 ABGB verlangt nicht nur eine Zurückstellung der Vorteile durch den unredlichen Bereicherungsschuldner, sondern verpflichtet diesen auch zum Schadenersatz. Die Voraussetzungen dafür sind hier gegeben, weil ein Steinschlag einen Sprung in der Frontscheibe verursachte und der Schaden damit Folge der Benützung des Fahrzeugs durch die Klägerin ist.
[53] 3.5. Ob die Klägerin nach § 335 ABGB der Beklagten gegenüber für den Schaden an der Windschutzscheibe einzustehen hat oder ob sie für diesen nach § 329 ABGB nicht verantwortlich ist, hängt von ihrer Redlichkeit im Zeitpunkt des Schadenseintritts ab. Es kommt also darauf an, ob die Klägerin beim Steinschlag von ihrem Gestaltungsrecht wusste. Bejahendenfalls wäre ihr nämlich bekannt gewesen, dass sie – sollte sie ihr Recht zur Anfechtung des Vertrags ausüben und in Folge dessen das Fahrzeug auch zurückgeben müssen – fortan eine wirtschaftlich fremde Sache benützt, wodurch sich die Gefahr einer Beschädigung erhöht.
[54] Aus den Feststellungen des Erstgerichts geht lediglich hervor, dass die Frontscheibe aufgrund eines Steinschlags einen Sprung erlitt und die Reparatur- samt Austauschkosten in einer Fachwerkstätte rund 1.500 EUR betragen würden. Wann dieser Schaden eingetreten ist und ob die Klägerin zu diesem Zeitpunkt bereits Kenntnis von ihrem Gestaltungsrecht (Vertragsanfechtungsrecht) hatte, ergibt sich aus den Feststellungen nicht. Aus diesem Grund kann noch nicht beurteilt werden, ob die Klägerin im Schadenszeitpunkt als unredliche oder redliche Bereicherungsschuldnerin zu qualifizieren ist.
[55] 3.6. Die Beklagte brachte in erster Instanz vor, dass die Frontscheibe einen Schaden aufweise, der Reparaturkosten in Höhe von 1.500 EUR nach sich ziehe, und dass sie insofern gegen die Klägerin einen Anspruch habe, den sie der Klageforderung compensando entgegenhalte. Anders als in den Fällen zu 2 Ob 241/22p (insb Rz 45) und 2 Ob 82/23g (insb Rz 16), wo jeweils ein Schaden wie der hier vorliegende vom dort Beklagten nur in Verbindung mit dem Benützungsentgelt releviert wurde und sich die gerichtliche Erörterungspflicht nach § 182a ZPO folglich auch nur im Rahmen des behaupteten Benützungsentgelts zu bewegen hatte, hat hier die Beklagte ohne Einschränkung – und damit gestützt auf jeden denkbaren Rechtsgrund – ihre Gegenforderung auf Zahlung der Reparaturkosten erhoben. Wann der Schaden entstanden ist und ob die Klägerin zu diesem Zeitpunkt bereits Kenntnis ihrer Anfechtungsmöglichkeit hatte, ergibt sich aus dem Vorbringen der Beklagten aber nicht; dieses ist im Lichte des § 335 ABGB somit (noch) unschlüssig.
[56] Nach § 182a ZPO hat das Gericht das Sach- und Rechtsvorbringen der Parteien mit diesen zu erörtern und darf seine Entscheidung auf rechtliche Gesichtspunkte, die eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, nur stützen, wenn es diese mit den Parteien erörtert und ihnen Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat (RS0037300 [T46]). Den Vorinstanzen ist damit eine Verletzung der Erörterungspflicht nach § 182a ZPO unterlaufen, was die Notwendigkeit einer Aufhebung des angefochtenen Urteils zur Vervollständigung des Verfahrens nach sich zieht. [57] Für den Fall, dass der Steinschlag zwar erst nach Kenntnis der Klägerin vom Anfechtungsgrund erfolgte, aber nach gerichtlicher (oder allenfalls vorausgegangener außergerichtlicher) Bestreitung des Anfechtungsanspruchs (Rückabwicklungsanspruchs) der Klägerin durch die Beklagte, wäre mit den Parteien zu erörtern, ob bestimmte Umstände die Weiterbenützung des Fahrzeugs durch die Klägerin unter Inkaufnahme des damit verbundenen Risikos seiner Beschädigung (zB durch Steinschlag) als gerechtfertigt erscheinen lassen. Auch wäre die Weigerung der entreicherten Beklagten, den Vertrag rückabzuwickeln und demnach das Auto zurückzunehmen, als Mitverschulden angemessen zu berücksichtigen (vgl Holzner in Rummel/Lukas, ABGB4 [2016] § 329 Rz 1; Kerschner in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3 [2018] § 1437 ABGB Rz 48).
[58] 4.1. Zusammenfassend war die angefochtene Entscheidung – als Teilurteil – insofern zu bestätigen, als diese nicht das Bestehen der Gegenforderung von 1.500 EUR betrifft; hinsichtlich dieser Gegenforderung waren die Entscheidungen der Vorinstanzen aufzuheben.
[59] 4.2. Die Kostenentscheidung beruht in Bezug auf das Teilurteil auf § 52 Abs 4 ZPO und in Bezug auf den Aufhebungsbeschluss auf § 52 Abs 1 Satz 3 ZPO.
Unsere Meinung dazu
Eine in mehrerlei Hinsicht interessante, aber auch erwartbare Entscheidung des OGH. Der Käufer eines Elektro-Fahrzeuges hat den Verkäufer (Autohauhändler) gefragt, wie weit das Fahrzeug tatsächlich fahre und zur Antwort bekommen: "200 km im Winter und 250 km im Sommer". Nach den Feststellungen der Unterinstanzen (Sachverständigengutachten) nimmt die Reichweite bei Temperaturen unter 0° C um ca. 10 % ab, sodass sie im Winter nur 175,5 bis 184,5 km beträgt. Der Verkäufer hat mit seiner unrichtigen Aussage den Irrtum des Käufers über die tatsächliche Reichweite adäquat verursacht. Die wörtliche Zusage einer „Mindestreichweite“ ist nicht erforderlich. Der Kaufvertrag ist rückabzuwickeln. Autoverkäufer müssen sich also gut überlegen, welche Angaben sie zu den Leistungsdaten ihrer Fahrzeug machen. Wenn konkrete Aussagen gemacht werden, müssen die auch stimmen. Keine Einwände.

